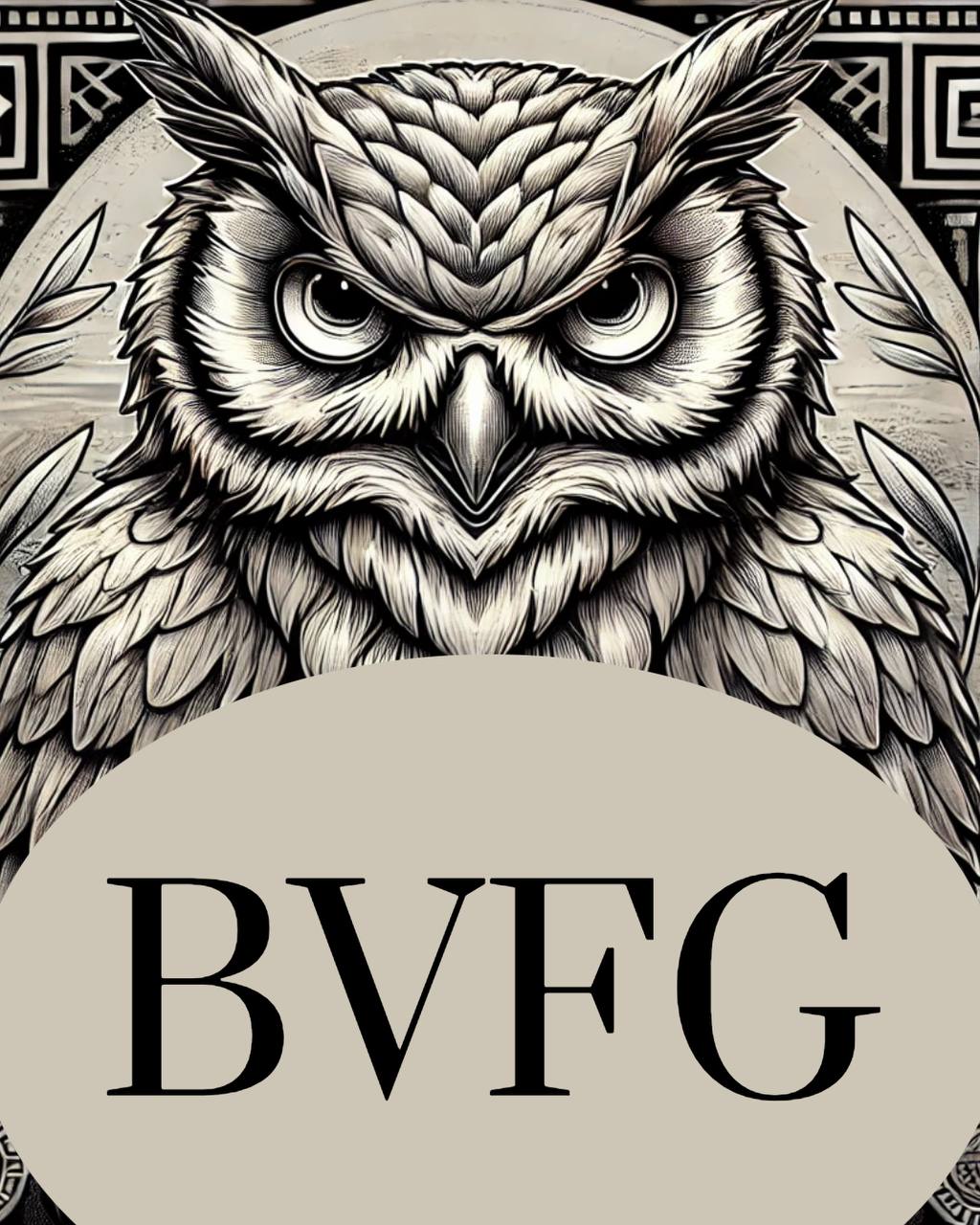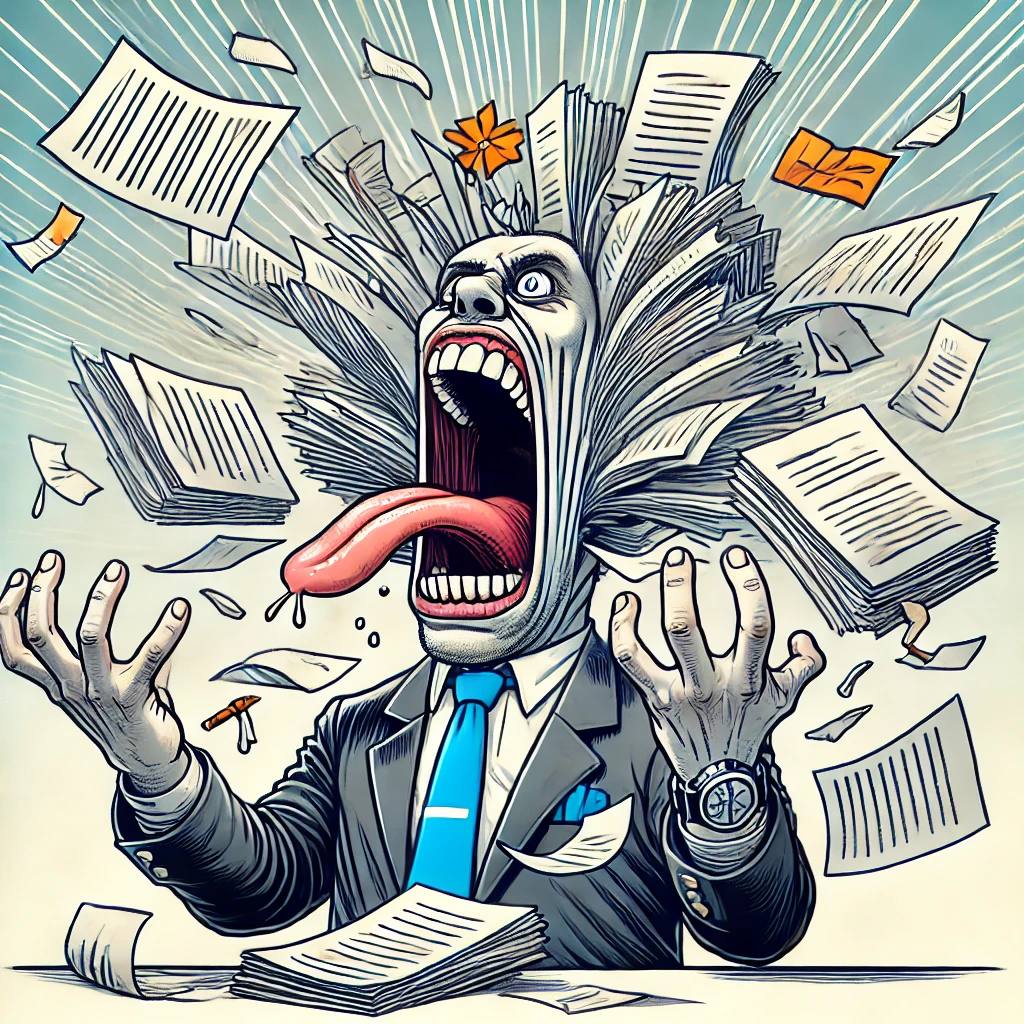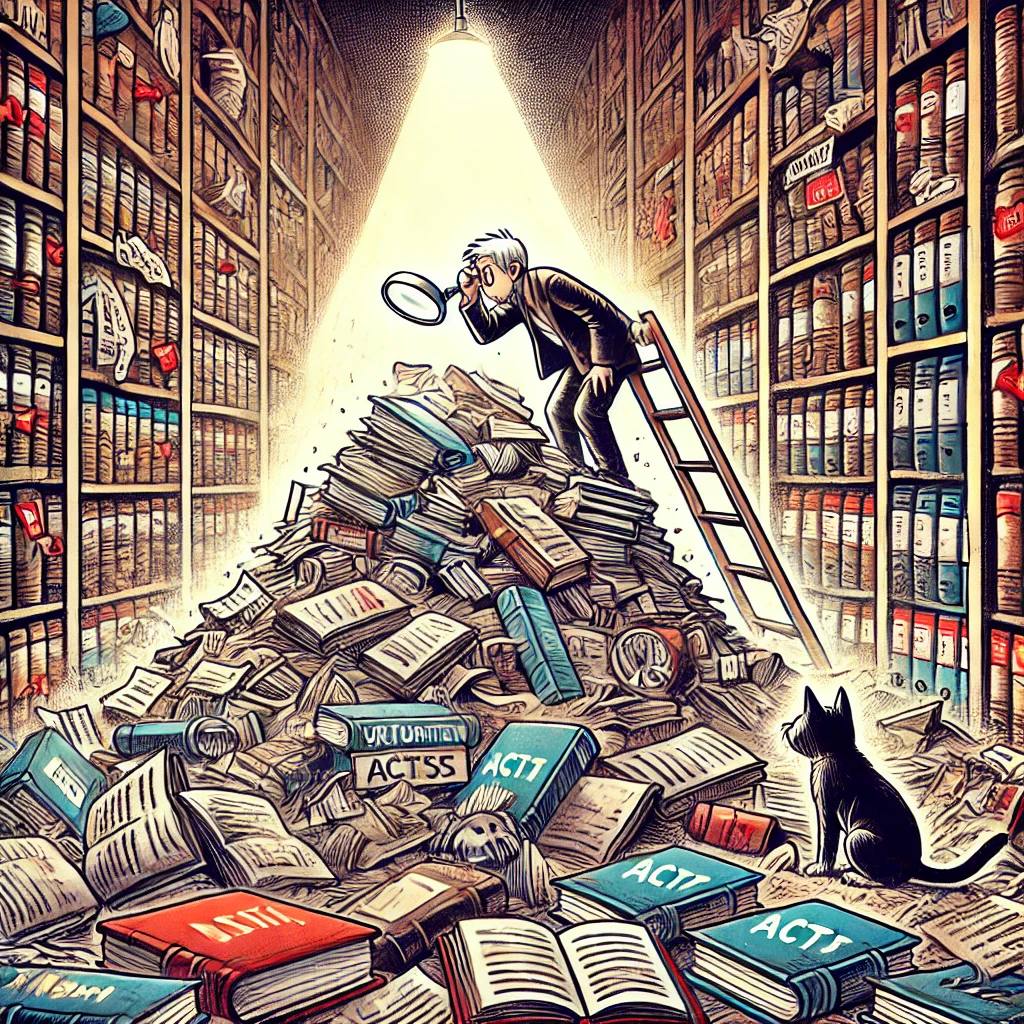Geschichte und Entwicklung des BVFG
Das Bundesvertriebenengesetz (BVFG) wurde 1953 verabschiedet, um deutschen Vertriebenen und Spätaussiedlern eine rechtliche Grundlage für ihre Integration in Deutschland zu geben.
Die letzten Änderungen des Gesetzes wurden im Jahr 2023 vorgenommen und haben zu einer Verschlechterung der Situation der Spätaussiedler geführt.
Warum waren die Änderungen von 2023 unzureichend?
Trotz der Reform von 2023 bestehen weiterhin schwerwiegende Probleme für Spätaussiedler und ihre Nachkommen.
Die größten Hürden sind:
Nach 1993 Geborene und die Einschränkungen des §7
Ein großes Problem für viele Nachkommen von Spätaussiedlern ist die gesetzliche Einschränkung für nach 1993 Geborene, die nicht eigenständig im Spätaussiedlerstatus nach Deutschland kommen können.
Warum ist das ein Problem?
- Nach 1993 Geborene können nur als Spätaussiedler anerkannt werden, wenn sie gemeinsam mit einem anerkannten Spätaussiedler (z. B. Eltern oder Großeltern) ausreisen.
- Sie haben kein eigenes Recht auf einen Antrag nach §7 BVFG und sind auf ihre Eltern oder Großeltern angewiesen.
- Oft verweigern Eltern oder Großeltern die Ausreise, wodurch die Nachkommen keine Möglichkeit mehr haben, den Spätaussiedlerstatus zu erhalten.
Folgen dieser Regelung
1. Ungerechte Benachteiligung junger Menschen
- Menschen mit identischer Herkunft werden unterschiedlich behandelt – nur wegen ihres Geburtsdatums.
- Vor 1993 Geborene können eigenständig einen Antrag stellen, nach 1993 Geborene nicht.
2. Verlust junger, talentierter Fachkräfte
- Viele dieser jungen Menschen sind hochqualifiziert, integrationsbereit und weltoffen.
- Deutschland verliert jährlich tausende potenzielle Fachkräfte, die das Land wirtschaftlich und gesellschaftlich bereichern könnten.
3. Zusätzliche Belastung für das soziale System
- Ältere Spätaussiedler müssen ausreisen, um ihren Nachkommen die Anerkennung zu ermöglichen.
- Junge, arbeitsfähige Nachkommen dürfen nicht einreisen, während ältere Generationen mit höherem Unterstützungsbedarf einreisen.
Warum muss diese Regelung geändert werden?
Deutschland verliert jedes Jahr junge, talentierte und weltoffene Menschen, die zur Gesellschaft und Wirtschaft beitragen könnten.
Lippenbekenntnis und die BVFG-Änderung 2023
Das Lippenbekenntnis bezieht sich auf die Praxis, Antragstellern den Spätaussiedlerstatus zu verweigern, wenn sie in der Vergangenheit eine andere Nationalität in offiziellen Dokumenten angegeben haben.
Warum ist das problematisch?
- Viele Russlanddeutsche mussten in der UdSSR ihre Nationalitätsangabe ändern, um Diskriminierung oder Repressionen zu vermeiden.
- Nach dem Zerfall der UdSSR wurde die deutsche Nationalität oft wiederhergestellt, doch das BVA betrachtet frühere Änderungen als Beweis für ein Lippenbekenntnis.
- Antragsteller, die nachweislich deutscher Herkunft sind, werden allein aufgrund einer früheren sowjetischen Praxis vom Spätaussiedlerstatus ausgeschlossen.
Auswirkungen der Gesetzesänderung 2023
1. Verhärtung der Ablehnungspraxis
- Trotz der Ankündigung, das Lippenbekenntnis abzuschaffen, wurden durch die Änderungen von 2023 neue Formulierungen im Gesetz eingefügt.
- Diese ermöglichen es Gerichten, Anträge weiterhin auf Basis des Lippenbekenntnisses abzulehnen.
2. Gerichtliche Praxis – besonders in Köln
- Das Verwaltungsgericht Köln lehnt nahezu systematisch Anträge ab, wenn Antragsteller in der Vergangenheit eine andere Nationalität in ihren Dokumenten hatten.
- Dies zeigt, dass die angebliche Reform nicht umgesetzt wurde, sondern das Gegenteil eingetreten ist.
3. Ungerechtigkeit für Betroffene
- Viele Spätaussiedler haben keine bewusste Entscheidung gegen ihre deutsche Herkunft getroffen, sondern waren Opfer staatlicher Politik.
- Anstatt ihnen eine Rückkehr zu ermöglichen, wird ihre Abstammung durch Bürokratie infrage gestellt.
Anstatt das Lippenbekenntnis abzuschaffen, wurde es durch die neue gesetzliche Definition offiziell verankert, was zu einer noch restriktiveren Praxis führt.
Abstammungsnachweis – immer strengere Anforderungen durch das BVA
Das Bundesverwaltungsamt (BVA) fordert immer mehr Nachweise der Herkunft – oft mit unrealistischen Anforderungen.
Warum ist das problematisch?
- Für ein Erbe reicht es aus, wenn dein Großvater als Vater in der Geburtsurkunde deines Vaters eingetragen ist.
- Für den Spätaussiedlerstatus jedoch wird zusätzlich die Heiratsurkunde der Großeltern verlangt – andernfalls wird dein Vater nicht als leiblicher Sohn seines Vaters anerkannt.
Historische Realität der Russlanddeutschen
1. Heiratsverbot und fehlende Dokumente
- In den Kommandanturen der UdSSR konnten viele deportierte Deutsche keine Ehen offiziell registrieren.
- Viele Ehen wurden erst nach der Aufhebung der Kommandantur nachgetragen.
2. Bürokratische Hürden und staatliche Willkür
- Auch nach der Kommandantur waren viele Dokumente nicht vollständig oder wurden vernichtet.
- Trotzdem verlangt das BVA eine lückenlose Abstammung über mehrere Generationen hinweg.
3. Absurd hohe Anforderungen an Nachweise
- Es gibt keine plausiblen Gründe, die Vaterschaft von offiziell eingetragenen Vätern infrage zu stellen.
- Dennoch werden unglaublich hohe Hürden gesetzt, um eine Abstammung zu beweisen.
Diese Praxis stellt eine unverhältnismäßige Bürokratisierung dar und widerspricht der historischen Realität.
Probleme mit der Forderung nach Originaldokumenten und der Ablehnung nachträglich ausgestellter Unterlagen
Ein weiteres großes Hindernis ist die Forderung nach Originaldokumenten aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert sowie die Ablehnung von nachträglich ausgestellten Dokumenten.
Die drei größten Probleme:
1. Forderung nach Originaldokumenten aus der Zarenzeit
- Das BVA verlangt Originale aus den 1880er bis 1930er Jahren, obwohl diese oft durch Kriege, Deportationen und Enteignungen verloren gingen.
2. Ablehnung von nachträglich ausgestellten Dokumenten
- Viele Russlanddeutsche haben nach 1991 erneut ausgestellte Dokumente erhalten, da ihre ursprünglichen während der Sowjetzeit zerstört wurden.
- Das BVA lehnt diese systematisch ab, selbst wenn sie von offiziellen Behörden der Nachfolgestaaten der UdSSR beglaubigt wurden.
3. Paradoxe Forderung nach Rehabilitationsbescheinigungen vor 1990
- Die Rehabilitation der Russlanddeutschen fand erst in den frühen 1990er Jahren statt.
- Trotzdem verlangt das BVA Nachweise mit einem Ausstellungsdatum vor den 1990er Jahren, obwohl diese historisch nicht existieren können.
Diese Anforderungen führen dazu, dass viele Spätaussiedler nur aufgrund fehlender historischer Dokumente von der Anerkennung ausgeschlossen werden.
Warum Deutschland von einer Gesetzesänderung profitieren würde
Eine gerechtere Regelung für Spätaussiedler stärkt Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft.
Mehr qualifizierte Fachkräfte
- Viele Nachkommen von Spätaussiedlern sind gut ausgebildet und integrationsbereit.
- Eine erleichterte Anerkennung würde qualifizierte Arbeitskräfte schneller in den deutschen Arbeitsmarkt bringen und so dem Fachkräftemangel entgegenwirken.
Höhere Steuereinnahmen & Entlastung des Sozialsystems
- Durch eine schnellere Integration in den Arbeitsmarkt würden Spätaussiedler früher Steuern zahlen und in die Renten- sowie Sozialkassen einzahlen.
- Dadurch könnten langfristig staatliche Sozialleistungen gesenkt und die öffentliche Haushaltslage verbessert werden.
Effizientere Verwaltungsprozesse
- Weniger langwierige Prüfungen und aufwendige Einzelentscheidungen würden die Behörden entlasten.
- Schnellere und transparentere Verfahren würden nicht nur Spätaussiedlern, sondern auch der gesamten Verwaltung zugutekommen.
Mehr gesellschaftlicher Zusammenhalt
- Eine gerechte Lösung für Spätaussiedler würde zur gesellschaftlichen Harmonie beitragen und das Vertrauen in die deutsche Rechtsstaatlichkeit stärken.
- Deutschland würde seiner historischen Verantwortung gegenüber den Russlanddeutschen gerecht werden, was die gesellschaftliche Integration nachhaltig verbessern würde.